Es knallt. Über dem Rhein explodieren Raketen. Es sind die Kölner Lichter, das grösste musiksynchrone Feuerwerk Europas. Doch Greta wähnt sich zurück im Krieg, als sie mit ihrer Familie vor den Bomben fliehen musste.
Greta ist 84 und hat beginnende Demenz. Sie möchte nicht, dass sich Sohn Tom in ihr Leben einmischt. Der möchte es eigentlich auch nicht. Die Diagnose passt nicht in seinen hektischen Alltag als Starmoderator, in dem sich alles um ihn selbst dreht.
Doch dann findet Tom bei seiner Mutter das Foto eines dunkelhäutigen Mädchens. Er begibt sich auf Spurensuche und enthüllt eine tragische Liebesgeschichte, die seine Mutter ihr Leben lang verfolgt hat – und die auch sein eigenes Leben prägt.
Mit «Stay away from Gretchen» ist Susanne Abel ein berührender Roman gelungen, in dem Tabuthemen auf grossartige Weise zur Sprache gebracht werden. Wir haben mit der Autorin über ihr Debüt und ihren persönlichen Bezug zu Demenz gesprochen.
alzheimer.ch: Frau Abel, Sie wohnen wie die Protagonisten Ihres Romans in Köln. Was verbinden Sie mit dieser Stadt?
Susanne Abel: Köln ist meine zweite Heimat. Ich wohne schon lange hier. Mir ist es wichtig, über das zu schreiben, was ich kenne.
Also lassen Sie sich von konkreten Orten und Personen inspirieren?
Genau. Tom habe ich in einem luxussanierten ehemaligen Versicherungsgebäude untergebracht. Und als ich einen Freund in dessen Wohnung direkt am Rhein besuchte, dachte ich: Das ist die Wohnung von Greta! Beim Schreiben lebten die Figuren um mich herum und ich hatte manchmal das Gefühl, ich müsste nur vor die Tür gehen, um Greta und Tom zum Kaffee zu treffen. Aber bitte schreiben Sie das nicht. Sonst denken die Leute, ich habe einen Knall.

Diese Gedankenspiele macht man als Autorin vermutlich häufiger.
Das passiert instinktiv. Figuren entwickeln ein Eigenleben und ich frage sie: Wohin willst du? Was brauchst du? Das ist ein innerer Prozess, nichts Bewusstes. Jede Figur hat etwas mit mir oder mir nahestehenden Menschen zu tun. Auf die eine oder andere Art kenne ich sie alle.
Wohin will denn Tom?
Tom war sein Leben lang auf der Flucht. Er hatte ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern. Dass er keine ernste Beziehung eingehen kann, hängt unter anderem mit der Depression seiner Mutter zusammen. Deshalb amüsiert er sich mit irgendwelchen Frauen – bis Jenny auftaucht und er nicht mehr weglaufen kann.
Tom macht eine Riesenentwicklung durch. Anfangs ist er unverbindlich und egozentrisch. Doch durch die Demenzdiagnose seiner Mutter wird er völlig aus der Bahn geworfen und muss sich seinen Themen stellen. Was hat Sie zu einer solchen Geschichte motiviert?
Meine eigene Familiengeschichte. Meine Mutter hat 12 Jahre lang mit Alzheimer gelebt. Das anzunehmen und sie durch die Krankheit zu begleiten, war eine grosse Herausforderung für mich.
Aber so schrecklich manche Erfahrungen waren, die Krankheit war auch ein Geschenk.
Meine Mutter war verbittert und eine eher harte Frau. Doch im Laufe des Vergessens hat sie auch das vergessen, und am Schluss war sie ein liebevoller Mensch. Wir haben geknuddelt und geschmust, wie ich das nicht einmal als Kind erlebt habe.
Mama sprach plötzlich über Dinge, über die sie zeitlebens geschwiegen hat. Da habe ich verstanden, warum sie nicht die Mutter sein konnte, nach der ich mich gesehnt hatte. Und ich verstand auch, wie wir zusammenhängen. Zum Beispiel, dass meine Entscheidung gegen Kinder gar nicht von mir kam, sondern eine Konsequenz des Schicksals meiner Mutter ist.
Über diese Verwobenheit wollte ich schreiben. Als ich 2015 sah, welche Emotionen die Flüchtlingswelle bei den älteren Menschen auslöste, die vor siebzig Jahren selbst geflohen waren, hatte ich meine Geschichte.
Sie verweben in Ihrem Roman die Fluchterfahrung der Weltkriegsgeneration mit der Flüchtlingskatastrophe 2015. Sind Leser:innen auf Sie zugekommen, um über ihre eigene Geschichte zu sprechen?
Einige. Sie sagten, sie konnten 2015 so gut nachvollziehen, wie es den Flüchtenden ging, weil sie es selbst erlebt haben. Als Flüchtlinge waren sie nicht willkommen. Ein Mann, der in den Fünfzigerjahren als Sohn von Schlesiern in einem schwäbischen Dorf geboren worden war, erzählte mir, er sei wie ein Aussätziger behandelt worden.
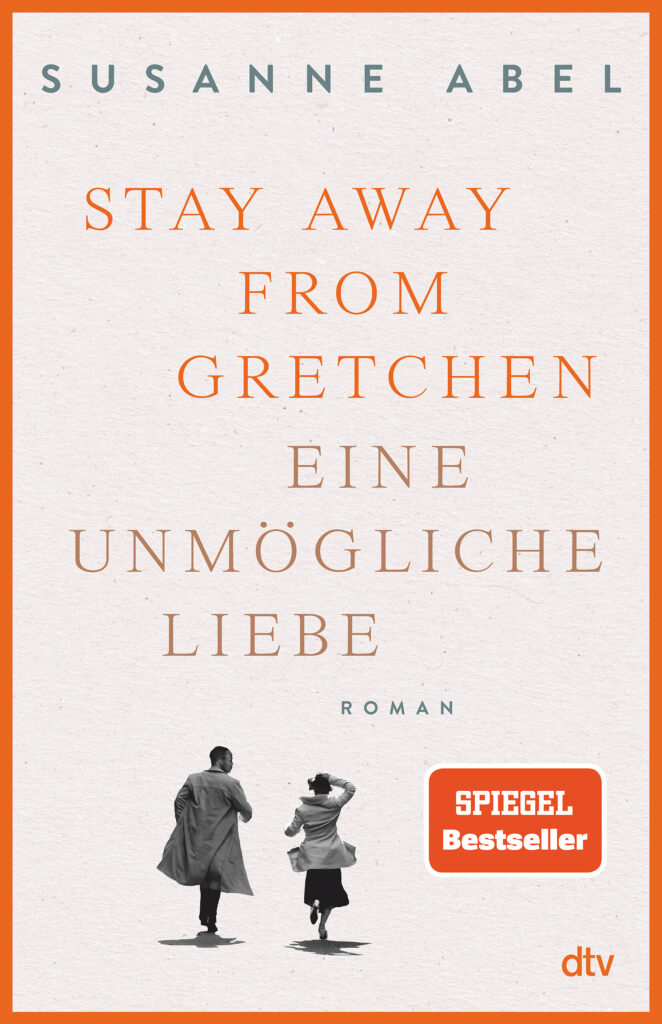
Was hat es mit dem Titel «Stay away from Gretchen» auf sich?
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten klare Weisungen, wie sie sich gegenüber der Bevölkerung zu verhalten hatten. Sie sollten nicht mit den Nazis fraternisieren. Eine Weisung lautete «Stay away from Gretchen» – Hände weg von den deutschen Mädchen, die sind alle syphilisverseucht. Das war die Parole.
An die sich keiner gehalten hat. Das Resultat waren unter anderem die «Brown Babies» oder «Mischlingskinder», Kinder zwischen deutschen Frauen und afroamerikanischen Soldaten.
In Deutschland immer noch ein Tabuthema. Es wurde verdrängt, wie schlimm die postfaschistische Gesellschaft mit diesen Kindern und deren Müttern umgegangen ist. Sie wurden diskriminiert und komplett allein gelassen.
Als ich das Buch schrieb, schwappte gerade die Black Lives Matter-Bewegung aus den USA nach Europa. Durch diese Bewegung kommt vieles an die Oberfläche, gerade was unseren täglichen Umgang mit dunkelhäutigen Menschen anbelangt.
Sie haben viel recherchiert. Erinnern Sie sich an Begegnungen, Erlebnisse, Zeitzeugnisse, die Sie besonders berührt haben?
Die Gespräche mit Zeitzeugen, die während des Weltkriegs Kinder oder Jugendliche waren, haben mich extrem berührt. Ein 80-jähriger Mann erzählte mir von seinem Vater, der im Krieg vermisst war. Er sass vor mir und weinte. Und ich sah das Kind in diesem alten Körper, das dieses Trauma sein Leben lang mitgeschleppt hat. Bis heute weiss er nicht, was aus seinem Vater geworden ist.
Eine Frau erzählte mir, dass sie mit 18 schwanger geworden ist und bis zur Geburt nicht wusste, wo das Kind rauskommt. Ihre Eltern waren tot und sie konnte niemanden fragen. Es ist ein großes Geschenk, dass mir diese und viele andere Menschen ihre Geschichte anvertraut haben.
Haben Sie auch mit ehemaligen Brown Babies gesprochen?
Ja, mit zwei Männern, die über den «Brown Baby Plan» in den USA eine Adoptivfamilie fanden. Von dieser privaten Initiative habe ich erst bei meiner Recherche gehört.
Die «Mischlingskinder» mussten Furchtbares ertragen. In Deutschland waren sie die «Negerkinder», in den USA die Kinder der Nazis.
Einer dieser Männer, der heute über 70 ist, lebt irgendwo im amerikanischen Hinterland. Er blieb heimatlos, weil er für die Deutschen zu schwarz und für die Afroamerikaner zu weiß war und keine Nation sich zu ihm bekannte.
Was ist der «Brown Baby Plan»?
In der Nachkriegszeit war es für Mütter von Brown Babies schwierig, ihre Kinder durchzubringen. Oft wurden sie von ihrer Familie nicht unterstützt, einen Sozialstaat gab es nicht. Da viele GIs diese Frauen sitzen liessen, waren sie alleinerziehend. Ein weiteres No Go.
Deshalb blieb einigen Müttern keine andere Wahl, als ihre Kinder in ein Heim zu geben. Vor allem die Heime in der Nähe der stationierten US-Army waren überfüllt mit Brown Babies. Um das Elend der Kinder zu lindern, rief Mabel Grammer den «Brown Baby Plan» ins Leben.
Grammer war Journalistin und die Frau eines amerikanischen Offiziers. Von Mannheim aus vermittelte sie Brown Babies zu Adoptiveltern in den USA. Obwohl Grammer damit vielen Kindern eine Zukunft schenkte, hatten leider nicht alle das Glück, in eine gute Familie zu kommen.










