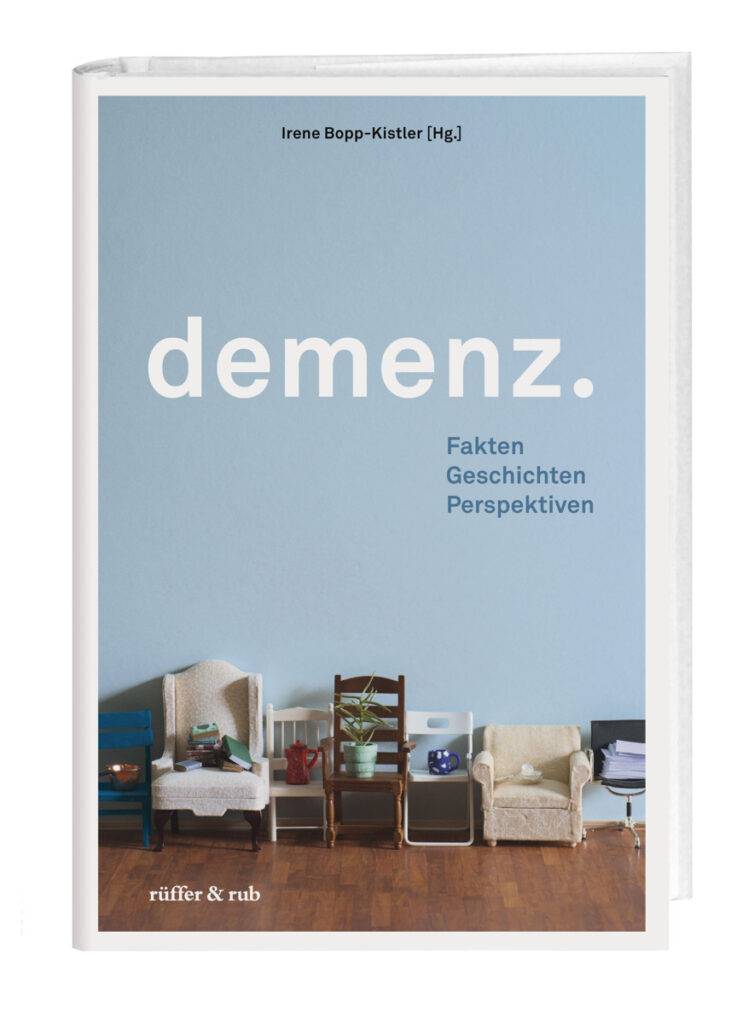Für mich war das eine sehr schwierige Zeit. Zu spüren, dass meine Mutter sich rasant veränderte, immer weniger sie selbst war, all dies erfüllte mich mit Trauer, Ohnmacht und Wut. Bei den gelegentlichen Treffen kannte sie mich zwar, und sie wusste noch, dass meine Frau etwas mit mir zu tun hatte, aber dass wir verheiratet waren, war gelöscht.
Schon beim nächsten Besuch konnte es sein, dass sie mich nicht mehr erkannte. Was dann? Offenbar eher mein Problem als ihres. Ich ertappte mich beim Gedanken, dass es mir lieber wäre, meine Mutter so in Erinnerung zu behalten, wie sie zu «Lebzeiten» war, und nicht als Hülle ihrer selbst.
Unweigerlich kommt man zu Fragen wie:
Was macht eigentlich das Menschsein aus? Wann hört der Mensch auf, Mensch zu sein (nicht auf die Menschlichkeit, sondern auf die Biologie bezogen)?
Was ist das Leben wert, und wie lange soll/darf/muss eine Gesellschaft im Namen der Menschlichkeit Körper pflegen, die nicht viel mehr sind als leere Hüllen? Welchen Wert haben Erinnerungen, Freundschaft und Zweisamkeit? Wann ist von all dem genug? Und dann natürlich die Frage des Loslassens als Kernproblem des Menschseins.
Loslassen: Es scheint, da wurde mir einmal mehr eine Übung vorgelegt. Ich selbst hatte dazuzulernen, nicht die Umgebung! Diese Erkenntnis machte mich lockerer im Umgang mit meiner Mutter.
Meine Eltern, das waren bis zu jenem Zeitpunkt sehr fleissige, einfache Bauersleute, die viel Mühsal und Arbeit auf sich nahmen, um ihr eigenes Gemüse, die eigenen Kartoffeln, die eigenen Früchte und Beeren heimzubringen. Allem Gekauften trauten sie nicht, und tatsächlich, wenn man gekaufte und eigene Waren verglich, so schwangen ihre Produkte qualitativ weit obenaus. Ihren Garten zu pflegen und sich an den Produkten zu freuen, das war ihr gemeinsames Hobby und ihr Stolz, seit sie beide pensioniert waren,Daneben züchteten sie Kaninchen und lange Zeit auch Hühner.
Mit der geistigen Veränderung, die stattfand, wurde meine Mutter zusehends träger und mochte nicht mehr so viel schaffen.
Dies hatte natürlich Konsequenzen für die Partnerschaft, es entfiel eine verbindende Basis.
Nach einigen Diskussionen, etwa zwei Jahre später, war sie endlich bereit, ihre Vergesslichkeit abklären zu lassen. Die Diagnose lautete Alzheimer. Ich glaube nicht, dass sie verstand, was die Ärzte damit meinten, oder was das überhaupt mit ihr zu tun haben sollte. Ihr ging es ja gut, sie war, wenn sie jemand fragte, kerngesund und rundum zufrieden.
Rückblickend werde ich den Eindruck nicht los, dass meine Mutter zu Beginn ihrer Demenz einen Schalter auf «Ich will nicht mehr» kippte,
vermutlich noch zusätzlich verstärkt durch die Nichtakzeptanz ihrer Krankheit und
das dauernde Bewusstmachen ihres Versagens durch Familienmitglieder.
Inzwischen ist meine Mutter in der Demenzabteilung eines Pflegeheims, in einer Umgebung, in der sie so akzeptiert wird, wie sie ist. Dort leben Menschen in fortgeschrittenem Alzheimerstadium zusammen, die kaum miteinander sprechen, in Teilnahmslosigkeit versunken, man lebt am selben Ort, aber jeder in seiner eigenen Welt.