alzheimer.ch: Der Verlauf einer Demenzerkrankung ist mit vielen Verlusten verbunden. Ist es ein Unterschied, ob ich sie als Ehemann, Geliebter, Bruder, Sohn, Neffe oder bester Freund erlebe?
Peter Christian Endler: Ich glaube, eine fortschreitende Demenz oder eine Demenzdiagnose kommt emotional fast dem Sterben gleich. Ob es ein Partner, ein Kind oder ein Geschwister ist, spielt keine Rolle. Es ist vor allem ein vorweggenommenes Abschiednehmen. In der Praxis sehe ich: Allen Beteiligten geht es besser, wenn sie sich im Loslassen üben.
Im Leben kann man nicht alles kontrollieren – auch die gesunden Angehörigen können es nicht, emotional schon gar nicht. Die Beziehung, die mir jetzt so wichtig war, die vielleicht erfüllend oder anstrengend war, gibt es nicht mehr. Man muss offen sein für etwas Neues. Dies gilt für alle im engen Umfeld des Erkrankten.
Zur Person
Dr. Peter Christian Endler ist Gesundheitswissenschaftler und Tiefenpsychologe, Hochschullehrer und Psychotherapeut sowie Gruppenpsychoanalytiker, vor allem im gerontopsychiatrischen Setting. Im Frühjahr 2018 ist sein Buch «Der reflektierte tiefenpsychologische Fallbericht – Ein Lesebuch zu Angehörigenarbeit, Demenzbegleitung, Selbsterfahrung und Achtsamkeit» im Verlag facultas erschienen.
Vor der Diagnose kommt der Verdacht. Der Erkrankte verändert sich. Was löst dies bei seinem Partner aus?
Frustration, Ärger, Wut, Überforderung. Überlegenheit auch – es hängt sehr davon ab, wie die Beziehung vorher war. Es kann sein, dass Abhängigkeitsverhältnisse zementiert werden. Eine solche Abhängigkeit tut niemandem gut. Jetzt bin ich überlegen, und er ist krank: Auch das gibt es. Und: Man hadert mit dem Schicksal. Warum ich? Warum wir?
Diese beiden Fragen kommen immer wieder. Wie können Sie den Angehörigen beistehen, wenn Sie solche Gedanken und Gefühle haben?
Das Ziel ist, dass dieses Warum-ich-Gefühl losgelassen und aufgegeben wird. Vielleicht kann man es als Prüfung verstehen oder als einen Schritt auf dem gemeinsamen Weg. Dass die Beziehung sich verändert, ist kein persönlicher Angriff.
Man muss sich von diesem Gedanken verabschieden – und offen sein, für das, was da ist. Es gibt neue Chancen und neue Einblicke. Als Therapeut kann ich das Gefühl teilen, dass etwas ganz Schreckliches passiert, und an der Hilflosigkeit teilnehmen. Und ich kann neue Gesichtspunkte aufleben lassen.
Ich kann teilnehmen und trotzdem etwas ausserhalb stehen. Damit gebe ich dem Angehörigen die Chance, dass auch er teilnimmt, aber trotzdem ausserhalb steht. Er soll sich fragen, wo er steht und was von ihm nun erwartet wird.

Die Diagnose erleichtert, weil nun ein Grund für die Veränderungen benannt ist. Aber sie gibt die Gewissheit: Es geht abwärts, es werden Schwierigkeiten kommen, es wird zu einem Sterben auf Raten kommen.
Die Diagnose ist oft hilfreich für die Angehörigen. Im ganzen weiteren Prozess ist es sehr wichtig, dass differenziert wird zwischen der Person, die ich gekannt habe, und der Krankheit. Dies ermöglicht es, den Kontakt zur Person aufrechtzuhalten.
Der schrittweise Abschied ist eine Übung, weil wir alle vom Tod betroffen sein werden.
So gesehen ist es ein Übungsfeld, mit einer Krankheit umzugehen. Er kann nicht mehr Autofahren, sie erkennt mich nicht mehr, er spricht nicht mehr. Immer wieder heisst es: Abschied nehmen.
Inwiefern können die Angehörigen an diesem schmerzhaften Prozess wachsen?
Indem sie sich den Wirklichkeiten des Lebens stellen. Zu diesen Wirklichkeiten gehören Abschied nehmen, loslassen und sterben. Wenn sie mit dem Erkrankten einen guten emotionalen Kontakt haben und auf einer anderen Ebene mit ihm kommunizieren lernen, verändert sich das Bild, was der Mensch eigentlich ist.
Der Mensch ist nicht unbedingt der, der seine Telefonnummer und Adresse auswendig sagen kann – sondern der, der meine Hand hält.
So kann einem bewusst werden: Es sind grundlegende Dinge, die das Mensch-Sein ausmachen. Dies macht mehr Sinn, als daran zu verzweifeln, dass dieses und jenes nicht mehr funktioniert.
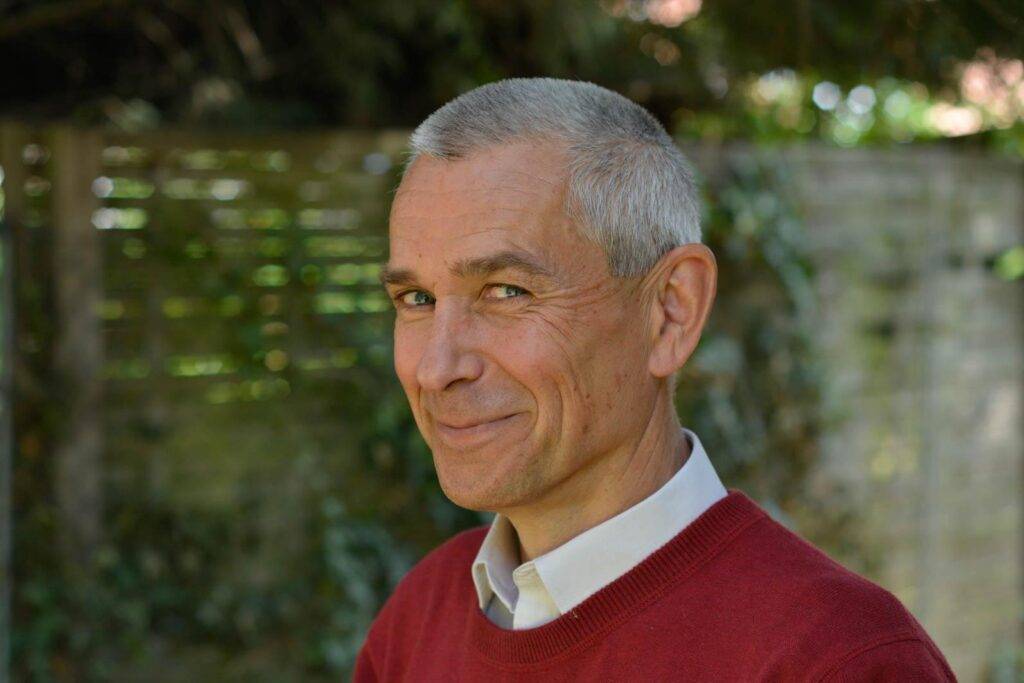
In Ihrem Buch «Der reflektierte tiefenpsychologische Fallbericht» sprechen die Angehörigen immer wieder davon, wie wichtig es sei, im Hier und Jetzt zu leben und zu denken.
Im Leben mit dement werdenden Menschen ist dies ein enorm wichtiges Instrument. Es ist ohnehin sinnlos, sich über das Übermorgen Gedanken zu machen. Ich mache das, was jetzt zu machen ist. Diese Lebenshaltung ist befreiend – für den Betroffenen und den Angehörigen, der dadurch Freiraum bekommt.
Einige Angehörige berichten von der Angst, selbst dement zu werden…
In der Arbeit mit den Angehörigen bedrückt mich dieses Gefühl auch. Kann es auch mich treffen? Was kann ich vorbeugend tun? Man sollte mit diesen Ängsten umgehen lernen. Dafür ist das Sein im Hier und Jetzt sehr gut. Auch zum Aufbau der kognitiven Reserven ist es gut, wenn man das, was gerade da ist, annehmen kann.
Man sollte nicht in alle Richtungen denken und sich dauernd ablenken. Mit dieser Ausrüstung – annehmen, was da ist – ist ein Loch, eine Krise auch in anderen Situationen leichter zu bewältigen.
Menschen, die in ihrem Leben gute Gewohnheiten aufgebaut haben, tun sich auch leichter, wenn sie dement werden. Ich kenne Menschen, die mit 90 manifest dement wurden und nach zwei Jahren gestorben sind. Man kann sich lange über Wasser halten mit guten Gewohnheiten.










