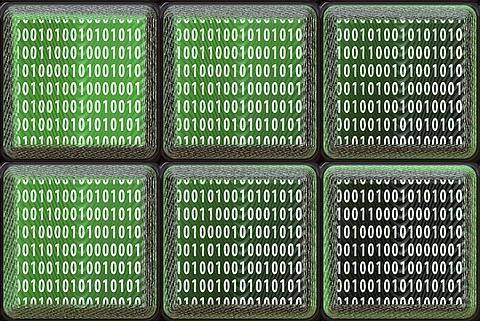Beim Stichwort Big Data bekommen Viele leuchtende Augen, bei Skeptikern dagegen schrillen die Alarmglocken. Mit der voranschreitenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen steigt selbstredend auch im Gesundheitswesen die Menge der gesammelten Daten rasant an.
Dass in einem Spital bei der Untersuchung, bei der Überwachung oder im Labor täglich riesige Mengen an Patientendaten gesammelt werden, ist nicht neu. Neu sind die Bemühungen von Forschern und Forscherinnen, diese Daten systematisch und strukturiert zu analysieren, zu verknüpfen und zu interpretieren.
Mit der immer grösseren Menge und Vielfalt beginnen auch die Herausforderungen. Oder wie es Professor Michael Simon, Bereichsleiter der universitären Forschung Pflege/Hebammen der Berner Inselgruppe, an einem Symposium in Bern1 formulierte:
«Big Data beginnt dort, wo es schwierig wird, die Daten zu analysieren.»
Die Digitalisierung verändert alle bisher bekannten zeitlichen und räumlichen Dimensionen, zum Beispiel bezüglich Speicherkapazitäten und Zugriffsmöglichkeiten. Die deutsche Gesundheitswissenschaftlerin Annemarie Schultz rechnet in ihrem Buch «Ökonomische Relevanz von Big Data» bis ins Jahr 2020 mit 2 Terabyte an gesammelten Daten pro Jahr und Mensch (1 Terabyte entspricht 420 000 Stunden MP4-Video).
Wer sich live einen Eindruck verschaffen will, was Geschwindigkeit rund ums Internet bedeutet, dem sei ein Blick auf die Website www.internetlivestats.com empfohlen.
Lieber smart als big
Entscheidend ist, was man mit diesen Daten macht. Der Fokus müsse klar beim Nutzen liegen – dies betonten alle Forscherinnen und Forscher, die am Inselsymposium ihre Ergebnisse präsentierten. Manche sprechen, denn auch lieber von «Smart Data», um den Nutzen für die Patientinnen und Patienten in den Vordergrund zu stellen.
Durch eine intelligente Verknüpfung der Daten müssten Wege gefunden werden, Patienten wirksamer und individueller zu therapieren und zu pflegen.
Solche personalisierten Methoden und Verfahren können laut Michael Simon dazu führen, dass für eine Patientengruppe unterschiedliche Therapien entwickelt werden. Statt einer Brustkrebstherapie für alle, gebe es dann vielleicht drei unterschiedliche Therapien, je nach Brustkrebsvariante.
Ein anderes Beispiel ist die Verbesserung der Leukämie-Therapie. Das Team um den Computerbiologen Moritz Garstung von der Universität Cambridge konnte mittels der Nutzung grosser Datensätze das Therapie-Design für Leukämie-Patienten um 30 Prozent effizienter machen.
Big Data in der Medizin

Die Firma Sophia Genetics in Lausanne. Globaler Leader in der datengetriebenen Medizintechnik. Quelle SRF
Nicht billiger, aber besser
Reinhard Riedl, wissenschaftlicher Leiter des Fachbereichs Wirtschaft der Berner Fachhochschule, geht noch einen Schritt weiter. Bei der Nutzung von Gesundheitsdaten müsse das Gemeinwohl im Vordergrund stehen.
Denn: Eine unkundige Nutzung von Big Data sei nicht nur ethisch zweifelhaft, sondern sie bringe auch keinen Nutzen. «Daten ohne Perspektiven sind wertlos», formuliert es Reinhard Riedl und ergänzt: «Perspektiven ohne Skills sind nutzlos.»