Als Michael Schmieder 1985 zum ersten Mal das Heim in Wetzikon besucht, stehen die Bewohnerinnen stumm und reglos hinter dem mannshohen Zaun. Damals ist das Gebäude noch eine triste Anstalt für psychisch kranke Frauen. Doch dann übernimmt Schmieder als Heimleiter das Ruder und macht die Sonnweid zu einem international führenden Demenzzentrum. Seine Erfahrungen teilt er in seinem vielbeachteten Buch «Dement, aber nicht bescheuert».
Nun ist das Nachfolgewerk erschienen: In «Dement, aber nicht vergessen» gibt Michael Schmieder acht Empfehlungen, was Menschen mit Demenz guttut und wie Betreuende mit der Erkrankung umgehen können. Wir haben den Autor auf einen Kaffee getroffen.
In deinem ersten Buch «Dement, aber nicht bescheuert» erzählst du aus deinem Erleben als Heimleiter. Worum geht es diesmal?
Michael Schmieder: 80 Prozent aller Menschen mit Demenz leben nicht im Heim, sondern zuhause. In «Dement, aber nicht vergessen» nehme ich diesen Bereich in den Blick: vom Symptombeginn über Aspekte im Leben mit Demenz bis hin zu Themen wie Tod und Sterbehilfe. Dabei gehe ich auch auf die Frage ein, was sich in Spitälern, Pflegeheimen und Quartieren ändern muss, damit Betroffene wie Angehörige eine gute Lebensqualität haben.
Demenz treibt Betroffene und Angehörige oft an die Grenzen der Belastbarkeit. Da wünscht man sich womöglich jemanden, der einem sagt, was man tun soll. Machst du das mit deinem Buch?
Natürlich möchte ich sagen: Hol dir rechtzeitig Hilfe! Aber damit ist es nicht getan. Die Frage ist: Was steckt dahinter? Warum eskaliert eine Situation? Was hindert Angehörige daran, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Oft hat das gar nicht mit der Demenz zu tun, sondern mit Beziehung.
Wir sind in unseren Mustern gefangen. Gerade in Ehesituationen ist es schwierig, über lange Zeit geprägtes Verhalten zu überdenken und zu ändern.
Aber es geht. Die realen – natürlich anonymisierten – Beispiele im Buch zeigen, was bestimmten Reaktionen zugrunde liegt, wie man sich Hilfe holen oder eine schwierige Situation auflösen kann. «Dement, aber nicht vergessen» ist kein Rezeptbuch, aber ein Leitfaden.
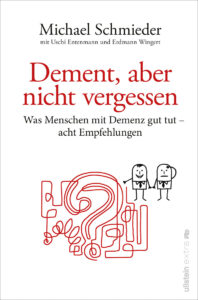
Du schreibst du nicht nur als Heimleiter, sondern auch als Angehöriger. Deine Schwiegermutter Rosmarie hatte Lewy Body Demenz. Hattet ihr, deine Frau Monika und du, einen Profi-Vorteil?
Auch in diesem Rollenkonflikt ist man primär Angehöriger. Ich als Schwiegersohn hatte mehr Distanz als meine Frau. Aber wir haben mit denselben Fragen gerungen wie andere. Zum Beispiel mit der Frage, wann es Zeit für den Heimeintritt war.
Ein Teil von uns wollte Rosmarie zuhause behalten. Beruflich aber haben wir die Erfahrung gemacht, dass niemand zu früh ins Heim kommt. Wer ein erkranktes Familienmitglied daheim betreuen möchte, muss sich fragen, unter welchen Umständen das möglich ist und warum man das möchte.
Du zeigst mit Anekdoten oder Rollenspielen, wie man mit Alltagssituationen umgehen kann. Oft sind es Kleinigkeiten, an denen sich Konflikte entzünden.
Zum Beispiel, wenn der demenzkranke Ehemann spontan zu einem Spaziergang aufbrechen will, obwohl es Winter ist und er keinen Mantel trägt – und er lässt sich partout nicht umstimmen. Wenn die Ehefrau ihn jetzt zurückhält, kann das aus dem Ruder laufen.
Was könnte sie stattdessen tun?
Mitgehen. Und wenn er trotz Kälte keinen Mantel anziehen will, muss sie abwägen, wie viel Gefahr dadurch tatsächlich droht. Anstatt zu sagen «Warte!», könnte sie reagieren mit «Warum gehst du?» und «Ich komme mit!».
Daran erkennt man auch die Qualität von Pflegeheimen. Es ist wichtig, etwas über das Krankheitsbild zu wissen. Als Betreuender muss man verstehen, warum jemand eine andere Sicht hat als ich, warum jemand so handelt. Wenn ich nachts aufstehe und mich auf den Weg zur Arbeit mache, weil ich mich für 40 halte, bringt es nichts, wenn mich ein Mann im weißen Kittel aufhält und sagt: «Sie müssen nicht arbeiten gehen, Sie sind ja schon 80!»

Ich habe immer wieder erlebt, dass in Heimen orientiert und beschwichtigt wird: «Sie sind doch jetzt bei uns, Herr S!», «Seien Sie doch ein bisschen lieb!». Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, kann ich mich nicht orientieren – und das macht Angst. Diese Binsenwahrheit hat mit Demenz nichts zu tun. Und darum geht es mir:
Wir müssen den Menschen in seinem Erleben verstehen, und nicht die Krankheit.
Eine einfache Sache.
Für viele zu einfach. Das Einfache, Normale wird oft nicht verstanden. Besonders wenn es zur Folge hat, dass man sein Handeln überdenken muss. Deshalb waren Validationskurse am Campus Sonnweid so schwer zu belegen: Bei Validation muss man sich auf eine andere Sicht einlassen.










